Solarbaupflicht: Mit sanftem Druck Solarpotenzial auf Dächern erschließen

Eine Katasterlösung könnte der lange gesuchte Konsens sein, um das PV-Potenzial auf Dächern zu nutzen. Eigentümer entscheiden bei Neubau oder Sanierung, ob sie selbst eine PV-Anlage bauen oder das Dach verpachten.
25.11.2020 – Die gesetzliche Verpflichtung für Bauherren, auf Neubauten eine Photovoltaikanlage zu errichten ist umstritten. Einige Kommunen und das Land Baden-Württemberg haben eine Solarbaupflicht für bestimmte Bauten bereits eingeführt.
Der Verband der Solarwirtschaft unterstützt diesen Weg nicht: Anreize seien besser als Pflichten, ist die Meinung der Branchenvertreter. Unstrittig ist jedoch, dass der Neubau von Solaranlagen vor allem in Städten längst nicht das vorhandene Potenzial ausschöpft.
In einem aktuellen Gutachten für das Umweltbundesamt wurden verschiedene Ausgestaltungsoptionen für eine bundesweite Photovoltaik-Pflicht untersucht und bewertet, die nun zur Diskussion stehen.
Wirtschaftlich zumutbar, wenig Bürokratie
Das im Gutachten beschriebene Modell setzt auf eine Nutzungs- oder Katasterpflicht für Dächer von Neubauten und nach Dachsanierungen. Eigentümer sollen sich entscheiden können: Entweder sie installieren und betreiben eine PV-Anlage selbst oder sie tragen ihre Dachfläche in ein Kataster ein, damit sie von einem Dritten für den Betrieb einer Solaranlage gepachtet werden kann.
Die PV-Pflicht ist damit eigentlich eine Nutzungs- oder Katasterpflicht und soll nur dann greifen, wenn sie für Gebäudeeigentümer wirtschaftlich zumutbar ist. Wollen die Eigentümer ihr Dach nicht selbst nutzen, müssen sie es in ein Kataster eintragen. Bei vorliegenden Angeboten dürfen sie die Fläche an Dritte zur Errichtung einer Solaranlage verpachten. So könnte nach Ansicht der Autoren sichergestellt werden, dass auf rentablen Dachflächen – und nur dort – PV-Anlagen errichtet werden.
„Diese Variante hat auch den Vorteil, dass die Wirtschaftlichkeit nicht für jede einzelne Fläche errechnet und nachgewiesen werden muss. Unnötige Bürokratie wird vermieden. In dem Moment, wo ein Planungsbüro die Fläche nutzen will, ist der Nachweis der Wirtschaftlichkeit erbracht“, erklärt Sebastian Palacios vom Öko-Institut.
Das Verpachtungskataster soll Transparenz zwischen Angebot und Nachfrage schaffen und die unterschiedlichen Akteure zusammenbringen. Der wirtschaftliche Gewinn, den die Verpflichteten durch den Betrieb einer Solaranlage oder durch die Verpachtung einer Gebäudefläche erzielen, könnte die Akzeptanz dieser Maßnahme erhöhen. Ohnehin haben PV-Anlagen auf Dächern weniger Akzeptanzprobleme und geraten mit dem Naturschutz nur selten in Konflikt – anders als zum Beispiel die Windenergie an Land.
EEG-Förderung und Kredite für größere Anlagen
Angefertigt wurde das Gutachten vom Öko-Institut und der Stiftung Umweltenergierecht. Sie untersuchten neben potenziellen Konflikten mit anderen Gesetzen auch mögliche Finanzierungsmodelle für Bau und Betrieb. Denn wenn eine größere Anlage auf dem kompletten Dach gebaut wird, ist das der Energiewende zuträglicher, als eine kleinere Anlage, die zwar eigenverbrauchs- und kostenoptimiert ist, aber nur einen geringen Teil der Dachfläche ausnutzt. „Nach unserer Prüfung könnte der durch die Photovoltaik-Anlagen erzeugte Strom auch mit einer PV-Pflicht weiter nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert werden“, sagt Nils Wegner von der Stiftung Umweltenergierecht. „Auch Förderkredite, etwa durch die KfW, könnten für private Hauseigentümer mit einer EEG-Förderung kombiniert werden.“
Pflicht als Anreiz-Instrument
Das Charmante an dem Vorschlag ist die Flexibilität, wieviel Pflicht an welcher Stelle auferlegt wird. Das Instrument bietet eine Reihe von Spielräumen: Beispielsweise könnte man das Kataster einführen, aber zunächst säumige Eigentümer moderat sanktionieren. Der Aufwand wäre gering und es könnte geprüft werden, welche Wirkung das Instrument in einer weicheren Form entfalten kann. Die Studie zeigt aber auch, wie das Instrument verschärft werden könnte, beispielsweise durch eine maximale Anzahl der Angebotsablehnungen. pf




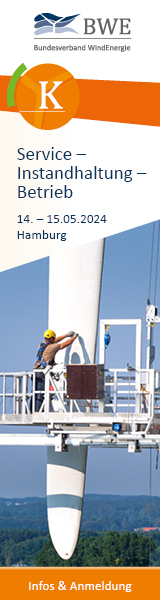

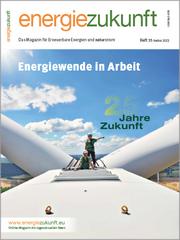


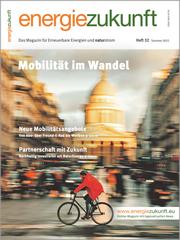


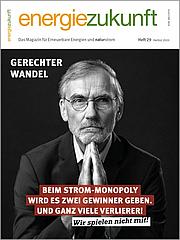
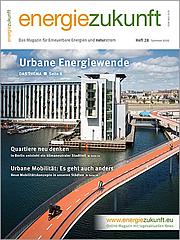
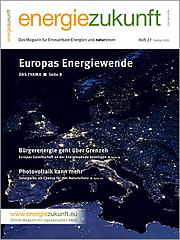
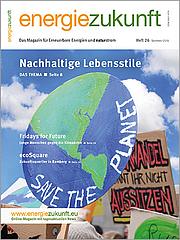
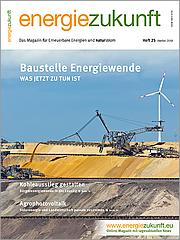




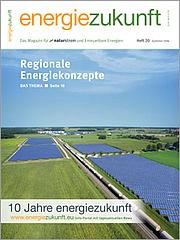
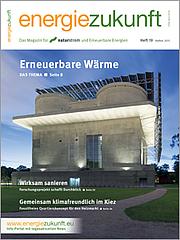
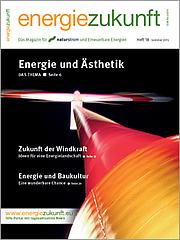




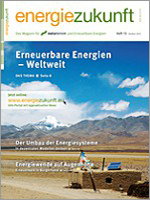




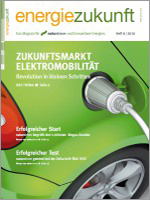
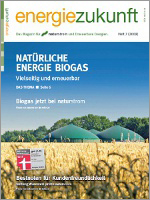

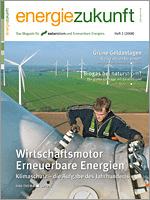


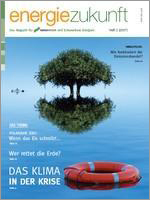


Kommentare
Diskutieren Sie über diesen Artikel
Andreas 05.05.2023, 13:00:12
Danke erstmal für den tollen Beitrag und die guten Informationen.
Ich finde eine Investition in eine Photovoltaikanlage lohnt sich in vielen Punkten.
1. Green Investing und sehr gut für die Umwelt
2. Hohe Pachtzahlungen über 40 Jahre
3. Passives Einkommen
Was sind eurer Meinung nach noch wichtige Punkte die für ein Investment in eine Photovoltaikanlage sprechen?
Ich habe hier eine gute Webseite für die Beratung und Betreuung von Grundstücksverpachtungen https://solar-direktinvest.de/grundstueck-verpachten/
Lg
Andreas
Manuel 22.06.2023, 13:19:41
Toller Beitrag zum Thema.
Sehr Informativ für mich.
Was haltet Ihr allgemein von einem Photovoltaik Investment?
Welche Daten und Fakten sollte man haben um eine gute Investitionsentscheidung zu treffen?
Gruß
Manuel
Christa 27.06.2023, 16:04:03
Danke für den Informativen Beitrag.
Was haltet Ihr von der Möglichkeit in ein Solar Direktinvestment zu investieren?
Also das man keine eigene Grundstücksfläche oder Dachfläche hat, sondern auf einem
bereits gebauten und verpachteten Grundstück dies tut?
Grüße
Christa
Karla 29.06.2023, 11:53:00
Interessanter und guter Beitrag.
Wir sind gerade dabei uns eine Photovoltaikanlage anzuschaffen und haben
auch von den Steuervorteilen gehört.
Könnt Ihr mir evtl. genau sagen welche Möglichkeiten es gibt bei einem PV Invest von der Steuer zu profitieren?
Lg
Karla
Bernd 30.06.2023, 13:30:34
Erstmal danke für den guten Beitrag!
Ich habe eine Frage, denkt Ihr es lohnt sich die eigene Dachfläche (wir haben 3 Stück
mit Scheunen) für eine Photovoltaikverpachtung zu nutzen? Oder lieber gleich selbst Module kaufen?
Was denkt Ihr ist wirtschaftlicher?
PS: Auf dieser Seite habe ich gute Informationen dazu gefunden: https://solar-direktinvest.info/
Beste Grüße
Petra Franke / energiezukunft 05.07.2023, 10:40:02
Lieber Stefan,
ob du die PV-Anlage selbst kaufst und betreibst oder dein Dach verpachtest, hängt vor allem von deinen finanziellen Möglichkeiten ab. Selbst Betreiber zu werden, bedeutet neben den Anschaffungskosten auch etwas Aufwand. Einfach Module kaufen - ganz so simpel ist es nicht. Bei der Verpachtung gibst du dem Pächter Zugang zum Dach, auch zu Wartungszwecken. In beiden Fällen stärkst du die Energiewende.
Viele Grüße
Stefan 04.07.2023, 13:42:58
Danke erstmal für den tollen und ausführlichen Beitrag.
Wir haben überlegt, ob wir auf unser Dach eine PV-Anlage bauen.
Wir sind uns aber nicht ganz sicher, wie sich das Investment lohnt.
Es gibt ja auch etwas von der Regierung noch dazu, in Form vom EEG.
Wist Ihr wie das mit der Einspeisevergütung geregelt ist?
BG
Stefan